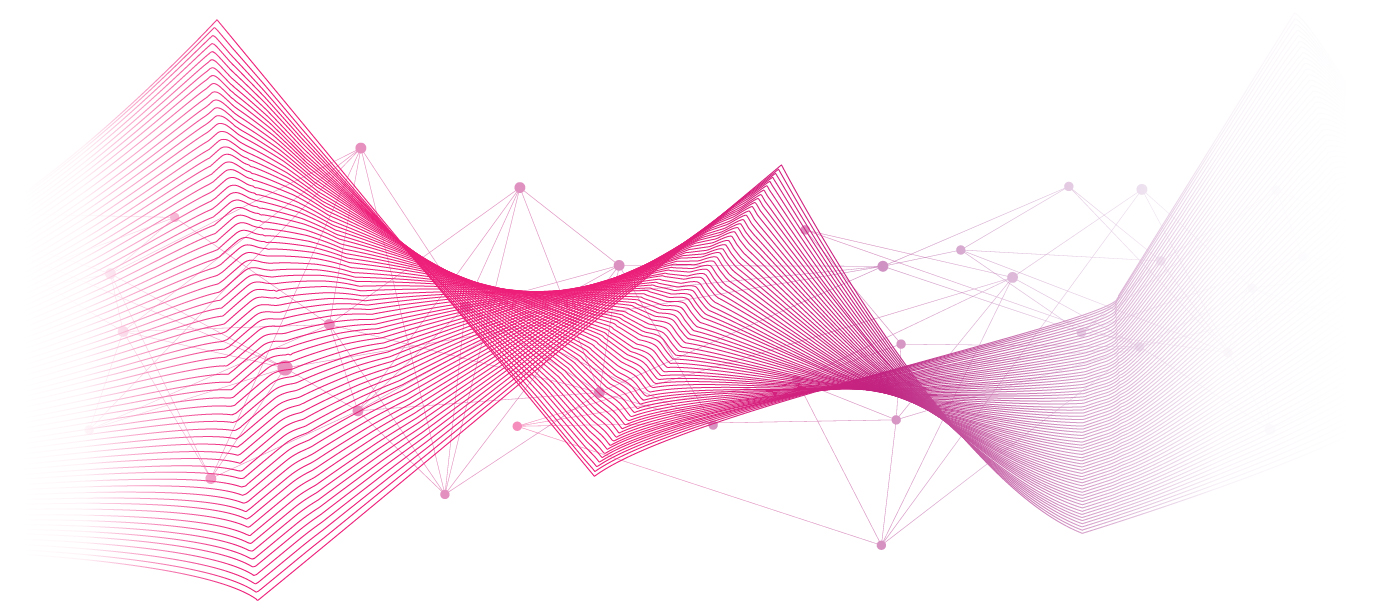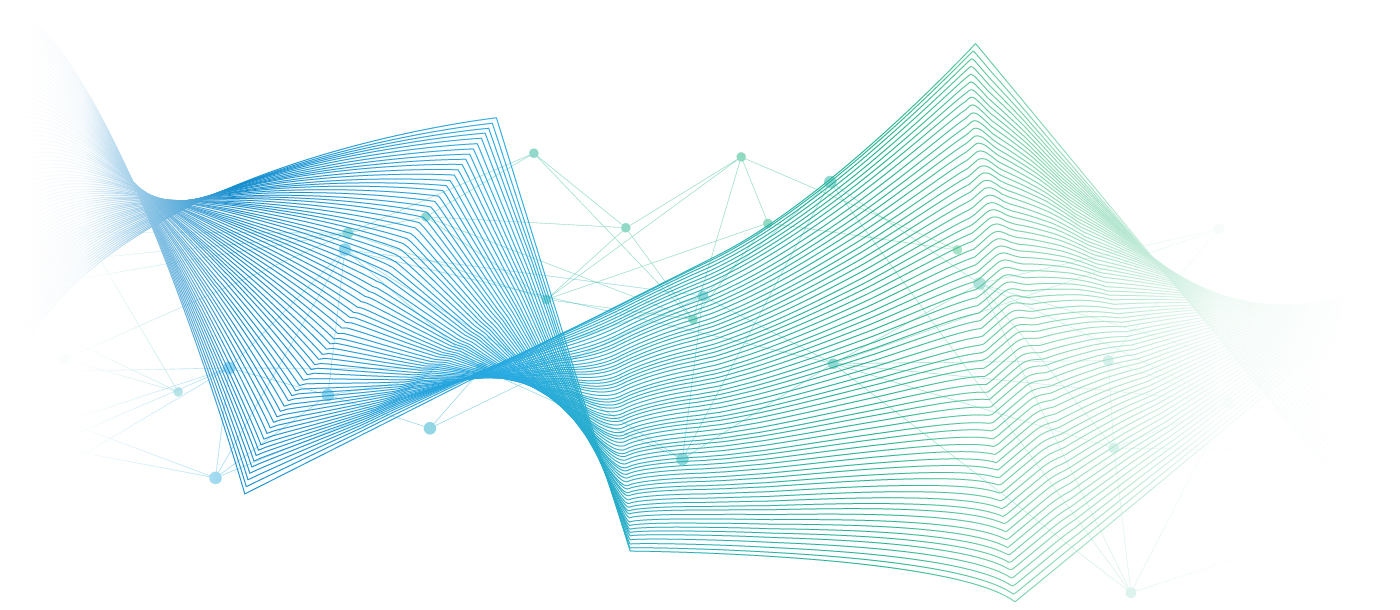Verletzt die Manipulation des Programmablaufs durch „Cheat-Software“ das Urheberrecht am Computerprogramm?

Auf eine Vorlage des Bundesgerichtshofs (BGH) musste der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit Urteil vom 17. Oktober 2024, Rs. C‑159/23 – Sony Computer Entertainment Europe Ltd dazu Stellung nehmen, wie weit der urheberrechtliche Schutzbereich eines Computerprogramms reicht.
Sachverhalt
Beim BGH ist eine Klage von Sony Computer Entertainment Europe Ltd gegen Datel Design Development Ltd u.a. anhängig.
Die Klägerin Sony Computer Entertainment Europe Ltd vertreibt als exklusive Lizenznehmerin für ganz Europa Spielkonsolen, darunter bis 2014 die PlayStationPortable (PSP), sowie Videospiele für diese Konsolen, darunter das Autorennen „Motorstorm Arctic Edge“.
Die Beklagte zu 1 entwickelt und produziert Ergänzungsprodukte für die PlayStation-Spielkonsolen; die Beklagte zu 2 vertreibt diese; der Beklagte zu 3 ist Director der Beklagten zu 2. Die Beklagten produzieren und vertreiben „Cheat-Software“ für die PSP, unter anderem die Programme „Action Replay“ und „Tilt FX“. Diese machen es möglich, den Ablauf des Spiels „Motorstorm Arctic Edge“ zu beeinflussen und damit gewisse im Spiel vorgesehene Beschränkungen aufzuheben.
Funktionsweise der Cheat-Software
Nach der Installation der jeweiligen Software auf einer PSP ist ein zusätzlicher Menüpunkt verfügbar: Mit der Option „Infinite Turbo“ können Nutzende für ihr Auto den Turbo („Booster“) unbegrenzt nutzen. Mit der Option „All drivers available“ können sie Charaktere (Fahrer) auswählen, die ansonsten erst bei höheren Punkteständen freigeschaltet würden.
Um das zu ermöglichen, läuft die jeweilige Cheat-Software gleichzeitig mit dem Computerspiel ab und verändert Variablen, die das Spiel während des Programmablaufs im Arbeitsspeicher (RAM) ablegt. Durch die veränderten Variablen wird dem Programm ein Zustand vorgespiegelt, der zwar im regulären Betrieb eintreten kann, aber nicht bei dem jeweiligen Spielstand eintreten würde. Dadurch wird der Spielverlauf gezielt verändert.
Bisheriger Prozessverlauf
Das Landgericht Hamburg gab der Klage weitgehend statt (LG Hamburg, Urteil vom 24. Januar 2012, Az.: 310 O 199/10). Es sah in der Veränderung des Programmablaufs eine „Umarbeitung“ des Computerprogramms, also eine dem Rechtsinhaber vorbehaltene zustimmungsbedürftige Handlung nach § 69c Nr. 2 Urheberrechtsgesetz (UrhG). Diese Vorschrift lautet:
„Der Rechtsinhaber hat das ausschließliche Recht, folgende Handlungen vorzunehmen oder zu gestatten:
2. die Übersetzung, die Bearbeitung, das Arrangement und andere Umarbeitungen eines Computerprogramms sowie die Vervielfältigung der erzielten Ergebnisse. Die Rechte derjenigen, die das Programm bearbeiten, bleiben unberührt.“
Das Hanseatische Oberlandesgericht folgte dieser Auffassung nicht; es wies die Klage in der Berufungsinstanz ab (HansOLG, Urteil vom 7. Oktober 2021, Az.: 5 U 23/12). Das Landgericht habe den Schutzbereich des Computerprogramms zu weit gezogen. Nur ein Eingriff in die „Programmsubstanz“, also eine Änderung des Quellcodes oder des (ablauffähigen) Objektcodes eines Computerprogramms, sei als „Umarbeitung“ anzusehen; eine Veränderung des programmgemäßen Ablaufs sei dagegen keine Veränderung des Computerprogramms selbst.
Vorlagefragen des BGH
Der BGH stellte fest, dass die Begründetheit der Klage von urheberrechtlichen Bestimmungen abhängt, die als Umsetzung europäischer Vorgaben richtlinienkonform auszulegen sind.
§ 69a Abs. 2 UrhG https://dejure.org/gesetze/UrhG/69a.html definiert den urheberrechtlichen Schutzbereich eines Computerprogramms wie folgt:
„Der gewährte Schutz gilt für alle Ausdrucksformen eines Computerprogramms. Ideen und Grundsätze, die einem Element eines Computerprogramms zugrunde liegen, einschließlich der den Schnittstellen zugrundeliegenden Ideen und Grundsätze, sind nicht geschützt.“
Diese Vorschrift und ebenso der oben zitierte § 69c Nr. 2 UrhG, der „Umarbeitungen“ eines Computerprogramms dem Rechtsinhaber vorbehält, beruhen auf der (jeweils wörtlichen) Umsetzung europarechtlicher Vorgaben, nämlich der Richtlinie 91/250/EWG des Rates vom 14. Mai 1991 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen, die inzwischen durch die Richtlinie 2009/24/EG ersetzt wurde. Daher konnte der BGH in der Sache nicht abschließend entscheiden, sondern legte dem EuGH die folgenden Fragen zur Vorabentscheidung vor (BGH, Beschluss vom 23. Februar 2023, Az.: I 157/21 – Action Replay):
1. Wird in den Schutzbereich eines Computerprogramms nach Art. 1 Abs. 1 bis 3 der Richtlinie 2009/24 eingegriffen, wenn nicht der Objekt- oder Quellcode eines Computerprogramms oder dessen Vervielfältigung verändert wird, sondern ein gleichzeitig mit dem geschützten Computerprogramm ablaufendes anderes Programm den Inhalt von Variablen verändert, die das geschützte Computerprogramm im Arbeitsspeicher angelegt hat und im Ablauf des Programms verwendet?
2. Liegt eine Umarbeitung im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2009/24 vor, wenn nicht der Objekt- oder Quellcode eines Computerprogramms oder dessen Vervielfältigung verändert wird, sondern ein gleichzeitig mit dem geschützten Computerprogramm ablaufendes anderes Programm den Inhalt von Variablen verändert, die das geschützte Computerprogramm im Arbeitsspeicher angelegt hat und im Ablauf des Programms verwendet?
Die erste Frage könnte man, am Wortlaut der Richtlinie und der deutschen Umstzung in § 69a Abs. 2 UrhG orientiert, auch so formulieren: Gehört der beabsichtigte Programmablauf (bei einem Computerspiel: der Spielverlauf) zu den geschützten „Ausdrucksformen“ des Computerprogramms? Falls diese Frage verneint wird, erübrigt sich die zweite Frage.
Entscheidung
Der EuGH verweist zunächst auf eine frühere Entscheidung zu der Frage, ob die grafische Benutzeroberfläche zum Schutzbereich des Computerprogramms gehört (EuGH, Urteil vom 22. Dezember 2010, Rs. C‑393/09 – Bezpečnostní softwarová asociace). Dort hatte der EuGH entschieden, der Schutzbereich umfasse gemäß der Richtlinie 2009/24/EG „die Ausdrucksformen eines Computerprogramms und das Entwurfsmaterial, das zur Vervielfältigung oder späteren Entstehung eines Computerprogramms führen kann“. Keine Ausdrucksformen des Computerprogramms seien dagegen dessen Schnittstellen wie die grafische Benutzeroberfläche, die die Kommunikation zwischen dem Computerprogramm und den Nutzenden ermögliche; diese sei nur ein Element des Computerprogramms, ermögliche es aber nicht, das Computerprogramm zu vervielfältigen.
In Fortführung dieses Ansatzes erkennt der EuGH auch die Funktionalität des Programms, die verwendete Programmiersprache und das Dateiformat nicht als „Ausdrucksformen“ des Computerprogramms an. Täte man dies, würde man „zum Schaden des technischen Fortschritts und der industriellen Entwicklung die Möglichkeit eröffnen, Ideen zu monopolisieren“. Nach dem Wortlaut von § 69a Abs. 2 UrhG sollen die dem Computerprogramm zugrundeliegenden Ideen und Grundsätze gerade nicht geschützt sein. Auch spreche Erwägungsgrund 15 der Richtlinie 2009/24/EG davon, dass (nur) die „nicht erlaubte Vervielfältigung, Übersetzung, Bearbeitung oder Änderung der Codeform einer Kopie eines Computerprogramms“ das Urheberrecht verletze.
Demnach seien nur Quellcode und Objektcode eines Computerprogramms als dessen „Ausdrucksformen“ anzuerkennen, nämlich als „buchstäblicher Ausdruck“ einer Folge von Befehlen; andere Elemente des Programms oder Elemente, mit denen die Nutzenden die Funktionalität des Programms nutzen (wie die Variablen im Arbeitsspeicher), seien dagegen keine Ausdrucksformen des Computerprogramms.
Angesichts der negativen Antwort auf die erste Vorlagefrage musste der EuGH die zweite Frage nicht mehr prüfen.
Hinweis für die Praxis
Die Klage von Sony wird der BGH auf Grundlage der Auslegung des EuGH abweisen müssen. Das bedeutet allerdings nicht, dass der Rechtsinhaber an einem Computerprogramm keinerlei Handhabe gegen „Cheat-Software“ oder ähnliche Manipulationen am Ablauf des Computerprogramms hätte. In seinem Urteil vom 21. Januar 2017, Az. I ZR 253/14 – World of Warcraft II hatte der BGH über einen auf das Wettbewerbsrecht gestützten Anspruch mit demselben Ziel zu entscheiden und bejahte diesen.
Der Betreiber des Massen-Mehrspieler-Online-Rollenspiels „World of Warcraft“ klagte gegen einen Anbieter sogenannter „Buddy-Bots“. Solche Bots (softwaregesteuerte, nicht menschliche Mitspielende) unterstützen eine:n Spieler:in im Online-Spiel und verschaffen ihm:ihr so einen Vorteil gegenüber den anderen Mitspielenden. Der Betreiber des Online-Spiels untersagt den Nutzenden eine solche Beeinflussung des Spielablaufs, die die Chancengleichheit verletzt, in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen; er versucht zudem, mit der Software-Komponente „Warden“ den Einsatz von Bots zu erkennen, um für die betreffenden Nutzenden das Spiel zu beenden. Die „Buddy-Bots“ waren besonders getarnt, um ihre Entdeckung zu verhindern.
Der BGH wertete das Anbieten der „Buddy-Bots“ als unlauteren Wettbewerb in Form der „gezielten Behinderung“ eines Mitbewerbers nach § 4 Nr. 4 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Eine produktbezogene unlautere Behinderung eines durch Allgemeine Geschäftsbedingungen ausgestalteten Geschäftsmodells liege vor, wenn die Spielregeln vom Betreiber des Online-Spiels in den AGB rechtlich verbindlich festgelegt seien und das beklagte Unternehmen durch das Unterlaufen von Schutzvorkehrungen, die eine Einwirkung verhindern sollen, auf das Produkt des Mitbewerbers einwirke. Diese Voraussetzungen waren im Fall von „World of Warcraft“ erfüllt.
Im Ergebnis kann also das Urheberrecht am Computerprogramm nicht in Stellung gebracht werden, um Manipulationen des Ablaufs und der Funktionalität des Programms zu untersagen, etwa durch „Cheat-Software“ oder durch „Mods“ (von „modification“) für ein Computerspiel, die dieses um weitere Charaktere, Schauplätze und Ähnliches ergänzen oder bestehenden Elementen ein anderes Aussehen verleihen. In geeigneten Fällen bietet sich aber das Wettbewerbsrecht an, um gegen solche Einwirkungen auf das eigene Produkt vorzugehen.