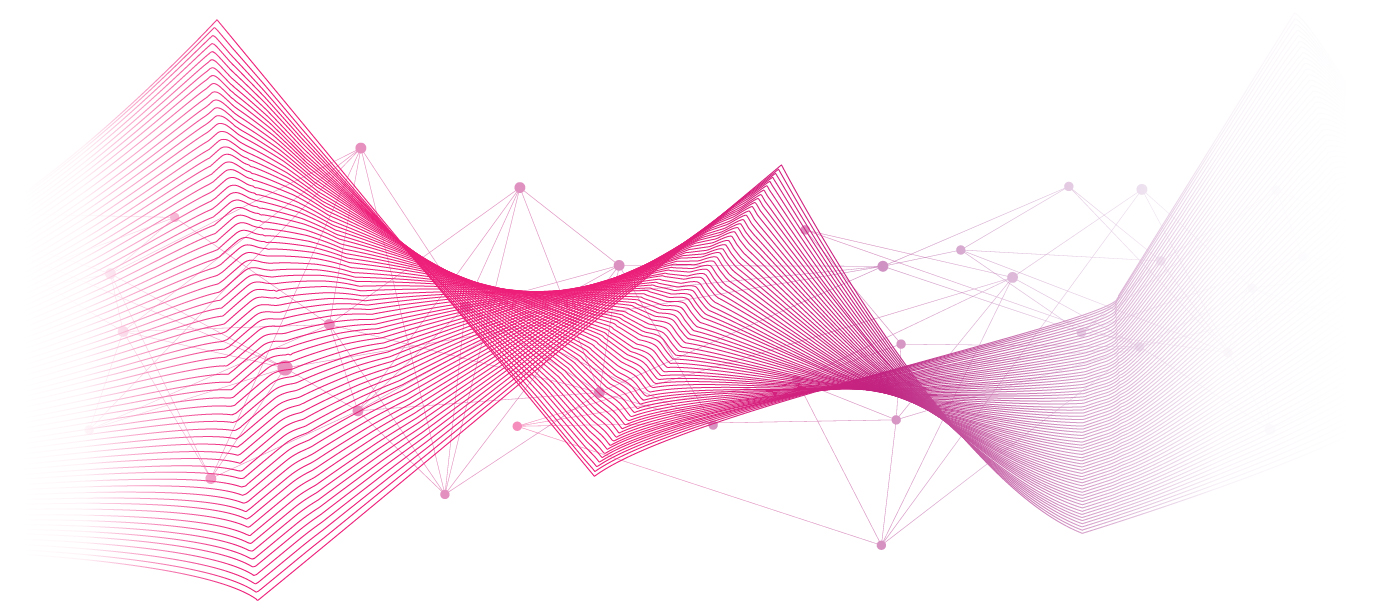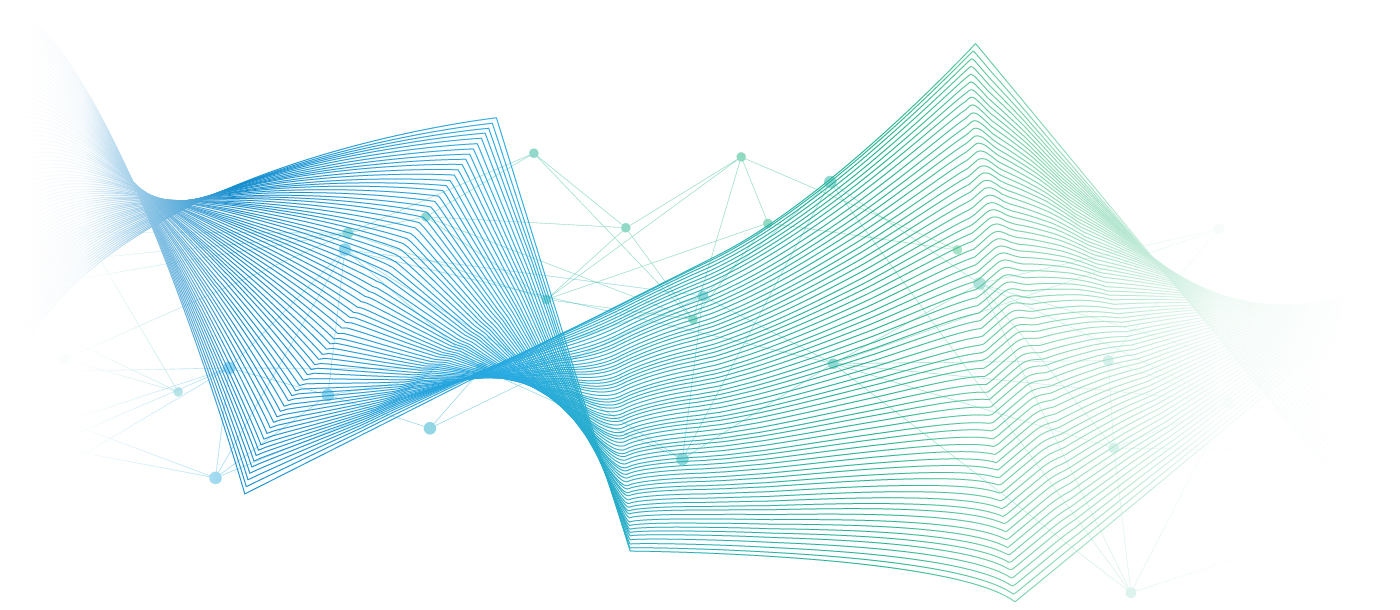Gegenstand des ersten Teils des Beitrags waren der Hintergrund und Anwendungsbereich der Regelung zum „Widerrufs-Button“ und die wesentlichen Vorgaben dafür im neuen Art. 11a der Verbraucherrechte-Richtlinie.
Weitere Unklarheiten bei der Umsetzung
Unternehmen müssen beim Widerrufsrecht und den damit verbundenen Informationspflichten bereits erheblichen Aufwand treiben. Die Erforderlichkeit der neu eingeführten Pflichten erschließt sich daher nicht recht. Umso ärgerlicher ist es, dass sie auch in den praktischen Details Fragen aufwerfen, die der Gesetzgeber nicht zu Ende gedacht und klar geregelt hat. Ganz offensichtlich haben sich die Verfasser:innen der Richtlinie nicht konkret gefragt, wie die Widerrufsfunktion in der Praxis „funktionieren“ soll.
Verfügbarkeit während der Widerrufsfrist
Problematisch ist schon die in Art. 11a Abs. 1 UAbs. 1 Satz 2 VRRL-neu enthaltene zeitliche Vorgabe für die Bereitstellung der Widerrufsfunktion, denn ersichtlich hat sich der Gesetzgeber nicht in die Situation des verpflichteten Unternehmens versetzt, wenn er fordert, dass die Widerrufsfunktion „während der gesamten Widerrufsfrist durchgehend verfügbar“ sein muss.
Das wirft sofort die Frage auf, ob es dem Unternehmen – im Umkehrschluss – verwehrt ist, die Widerrufsfunktion anzuzeigen, wenn kein Widerrufsrecht (mehr) besteht. In der Praxis wäre ein solcher Gleichlauf aber nur in Ausnahmefällen zu leisten
Ausschluss des Widerrufsrechts
Erst einmal müsste der Unternehmer feststellen, ob für einen konkreten Vertrag mit einem:einer Verbraucher:in das Widerrufsrecht nach § 312g Abs. 2 BGB ausgeschlossen ist, denn ohne Widerrufsrecht beginnt schon keine Widerrufsfrist zu laufen. Das gilt etwa für Verträge zur Lieferung schnell verderblicher Waren.
Ebenfalls ausgeschlossen ist das Widerrufsrecht aber auch bei „Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind,“ sowie „Verträgen zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung,“ wenn der:die Verbraucher:in die Versiegelung entfernt hat.
Das Unternehmen müsste also wissen, ob einer der Ausschlusstatbestände erfüllt ist – bei den zuletzt genannten Arten von Verträgen hängt das (vorzeitige) Erlöschen des Widerrufsrechts jedoch von einem Umstand ab, von dem das Unternehmen nicht rechtzeitig Kenntnis erhält. Wenn die Verbraucher:in widerrufen hat und entsiegelte Waren zurücksendet, liegt das Erlöschen des Widerrufsrechts bereits in der Vergangenheit.
Beginn der Widerrufsfrist
Nur in bestimmten Fällen wie beim Kauf eines Downloads oder der Buchung eines Webinars kann das Unternehmen ohne Weiteres wissen, wann die 14-tägige Widerrufsfrist beginnt: Dann gilt die Grundregel nach § 355 Abs. 2 BGB und der Vertragsschluss ist maßgeblich.
Bei einem Verbrauchsgüterkauf kommt es dagegen nach § 356 Abs. 2 BGB darauf an, wann der:die Verbraucher:in die Waren; bei getrennter Lieferung oder Teillieferungen die letzte Ware; bei regelmäßiger Lieferung, etwa im Rahmen eines Abonnements, die erste Ware; erhalten hat. Nur als Paket versandte Ware lässt sich verfolgen; bei Warenpost oder einer per Post zugestellten Zeitschrift gilt auch für den Fristbeginn, dass dieser von einem Ereignis abhängt, von dem das Unternehmen keine Kenntnis erhält.
Ablauf der Widerrufsfrist
Auch das Fristende zu bestimmen ist keineswegs trivial: Nach § 193 BGB endet eine Frist zur Abgabe einer Erklärung, also zum Beispiel die Widerrufsfrist, erst am nächsten Werktag, wenn der letzte Tag der Frist dort, wo die Erklärung abzugeben ist, d.h. am Aufenthaltsort des:der Verbraucher:in, auf das Wochenende fällt oder ein gesetzlicher Feiertag ist – also unter Umständen je nach EU-Mitgliedsstaat verschieden und in Deutschland bei bestimmten Feiertagen auch je nach Bundesland oder sogar Gemeinde verschieden. Alle Feiertage zu berücksichtigen wäre schon aufwendig genug, wenn das Unternehmen den Aufenthaltsort kennte; sicher bekannt ist ihm allenfalls der Wohnort, der aktuelle Aufenthaltsort kann nur vermutet werden.
Da die Widerrufsfrist auch abgesehen von diesen Unwägbarkeiten zu allererst einmal von der Person des:der Verbraucher:in abhängt, die einen widerrufbaren Vertrag geschlossen hat, stellt sich die Frage, wie das Unternehmen sicherstellen kann, dass die Widerrufsfunktion genau für diese konkrete Person während der für sie geltenden Frist verfügbar ist. Ist sie im Kundenkonto eingeloggt und sie in der letzten Zeit nur einen einzigen Vertrag geschlossen, könnte das Unternehmen im Prinzip sicherstellen, dass der Widerrufs-Button nicht vor Fristbeginn und nicht mehr nach Fristablauf angezeigt wird.
Bestehen mehrerer Verträge mit Widerrufsrecht
Schon wenn eine Person mehrere Verträge mit unterschiedlichen Widerrufsfristen geschlossen hat, wird aber unklar, was genau zu tun ist. Wurde der Vertrag ohne Kundenkonto im Wege einer Gastbestellung geschlossen, kann das Unternehmen nicht für die richtige Person (nämlich nur für diese) die Widerrufsfunktion „auf der Online-Benutzeroberfläche“ platzieren, da eine Website oder App für alle nicht eingeloggten Nutzenden gleich aussieht.
Sicher keine empfehlenswerte Option ist es, die Widerrufsfunktion nur für eingeloggte Nutzende gegebenenfalls anzuzeigen, da das die Anforderungen „durchgehend verfügbar“ und „leicht zugänglich“ verfehlen dürfte: Mit Urteil vom 10. Oktober 2023, Az.: 33 O 15098/22, hat das Landgericht München I zum vergleichbaren Kündigungs-Button entschieden, dass entgegen § 312k Abs. 2 BGB die Bestätigungsseite nicht „unmittelbar und leicht zugänglich“ ist, wenn ein:e Verbraucher:in sich nach Betätigen des Kündigungs-Buttons erst einloggen muss, bevor die Bestätigungsseite angezeigt wird.
Wie oben herausgestellt kann „Widerrufsfunktion“ sowohl die Schaltfläche „Vertrag widerrufen“ als auch die Eingabeseite bezeichnen. Letztere wäre hinter einer Log-in-Schranke aber nicht leicht zugänglich, da eine Hürde überwunden werden müsste; sie wäre auch nicht durchgehend verfügbar, wenn sie nur angezeigt würde, solange der:die Verbraucher:in eingeloggt ist.
Die Frage, ob ein Unternehmen die Widerrufsfunktion nicht zur Verfügung stellen darf, wenn kein Widerrufsrecht (mehr) besteht, muss man nach alledem klar verneinen, da das Recht nichts Unmögliches verlangen darf.
Es muss genügen, wenn das Unternehmen seine Informationspflichten erfüllt und die Verbraucher:innen (durch eine ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung und die relevanten Hinweise zum Ausschluss des Widerrufsrechts) darüber informiert hat, ob und innerhalb welcher Frist ein Widerrufsrecht besteht. Dem Unternehmen eine mögliche Irreführung von Verbraucher:inen durch die bloße Zurverfügungstellung der Widerrufsfunktion für sämtliche Nutzenden zur Last zu legen, hieße, die Verbraucher:innen für vollkommen uninformiert und unverständig zu halten. Es kann natürlich nicht schaden, die Verbraucher:innen auf der Eingabeseite unter Verweis auf die Widerrufsbelehrung und die Hinweise zu Ausschlusstatbeständen aufzufordern, zunächst zu überlegen, ob sie ein Widerrufsrecht haben, bevor sie zur Tat schreiten.
Ermöglichen eines Teilwiderrufs
Auch die folgende Aussage in Erw. 37 der Richtlinie sorgt nicht für Klarheit, sondern wirft selbst wieder Fragen auf:
„Wenn der Verbraucher im Rahmen desselben Fernabsatzvertrags mehrere Waren oder Dienstleistungen bestellt hat, kann der Unternehmer dem Verbraucher die Möglichkeit einräumen, statt des gesamten Vertrags nur einen Teil des Vertrags zu widerrufen.“
Ob der teilweise Widerruf eines Vertrags möglich ist, ist mangels einer klaren gesetzlichen Regelung dazu jeher umstritten.
Die EU-Kommission äußert sich in ihrer Bekanntmachung „Leitlinien zur Auslegung und Anwendung der Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die Rechte der Verbraucher“ (2021/C 525/01) (ausweislich etwa der englischen und französischen Fassung ist „Widerruf“ [=„withdrawal“, „rétraction“] gemeint, wo es in der deutschen Fassung „Rücktritt“ lautet, nachdem etwas weiter oben der richtige Ausdruck „Widerruf“ verwendet wurde) in Abschnitt 5.5.1 dazu wie folgt:
„Obwohl in der Richtlinie über die Rechte der Verbraucher ein solches Recht nicht ausdrücklich vorgesehen ist, hindert sie den Unternehmer und den Verbraucher auch nicht daran, einen teilweisen Rücktritt vom Vertrag durch Rücksendung lediglich einer einzelnen Ware oder aber mehrerer Waren, die im Zuge einer gemeinsamen Bestellung verkauft wurden, zu vereinbaren.“
Ebenso wie die Formulierung „kann […] einräumen“ lässt auch „hindert nicht, […] zu vereinbaren“ aber offen, ob rein nach dem Gesetz, also auch dann, wenn das Unternehmen sich nicht darauf einlassen will, ein Teilwiderruf wirksam ist. Immerhin erhellt daraus, dass ein Unternehmen einen Teilwiderruf ermöglichen kann.
Wenn es gesonnen ist, das zu tun, greifen die Vorgaben in Art. 11a Abs. 2 VRRL-neu für die Widerrufsfunktion (hier: die Eingabeseite) natürlich zu kurz. Angaben zur „Identifizierung des zu widerrufenden Vertrags“ genügen nicht, wenn der:die Verbraucher:in einen Teilwiderruf erklären will. Dafür müsste auch die Möglichkeit vorgesehen werden, den zu widerrufenden Teil des Vertrages, also bestimmte Waren und/oder Dienstleistungen, anzugeben.
Jedenfalls dürfte es nach dem Normzweck unschädlich sein, in dieser Hinsicht über Art. 11a Abs. 2 VRRL-neu hinauszugehen und weitere Angaben zu ermöglichen.
Was ist nun konkret zu tun?
Zum Glück hat der „Widerrufs-Button“ einigen Vorlauf. Die Mitgliedstaaten müssen die Richtlinie bis 19. Dezember 2025 in nationales Recht umsetzen; die neuen Vorschriften sollen dann ab 19. Juni 2026 anzuwenden sein.
Die Zeit bis dahin sollte genutzt werden, um die Widerrufsfunktion ohne Eile vorzubereiten, also die Gestaltung der Eingabeseite festzulegen und die Software für die Darstellung des Eingabeformulars und die Eingangsbestätigung zu programmieren. Es ist zu hoffen, dass der deutsche Gesetzgeber bei der Umsetzung von Art. 11a VRRL-neu einige der Unklarheiten beseitigt.
Zuletzt muss zum Stichtag 19. Juni 2026 in Widerrufsbelehrungen der oben angesprochene Hinweis auf die Widerrufsfunktion aufgenommen werden.