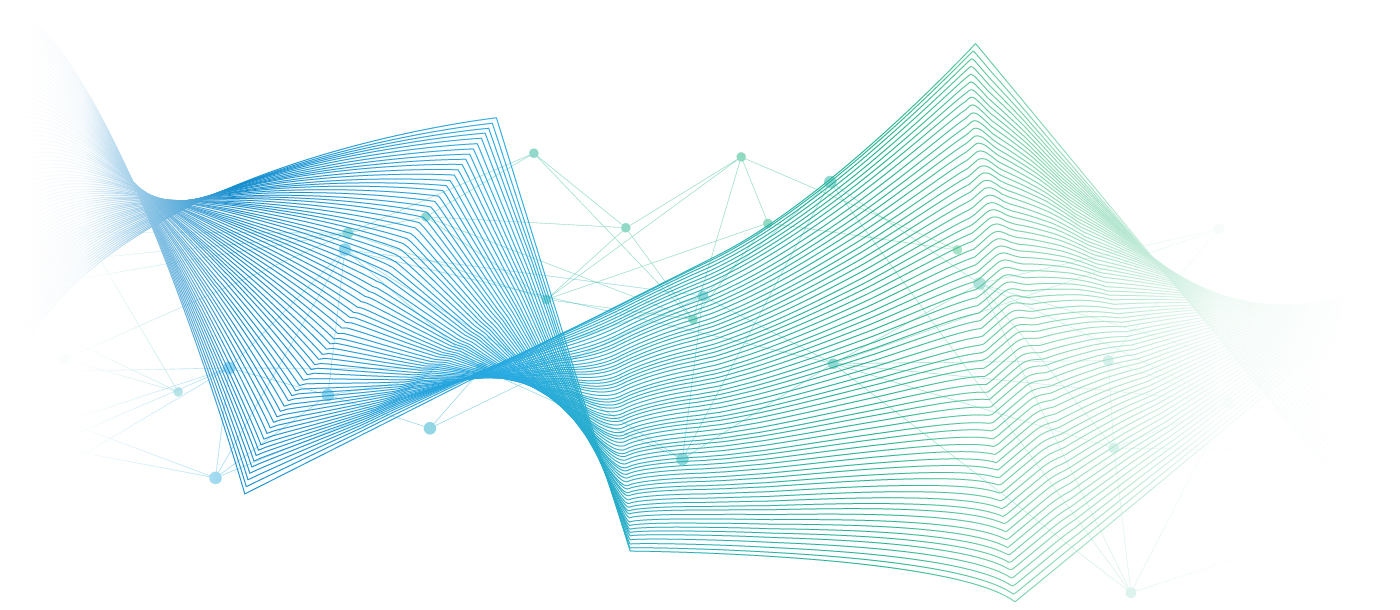Urheberrecht im Internet verletzt – Schadensersatz in Deutschland für die Welt?

Werden Urheberrechte im Internet verletzt, ist das Eintreiben von Schadensersatz häufig mühsam. Denn anders als bei analogen Verletzungen ist die Verletzung im Internet nicht lokal beschränkt, sondern findet „weltweit“ statt. Ein international tätiger Musikverlag hat nun (bislang erfolglos) versucht, für eine weltweite, unlizenzierte Nutzung einer Komposition einen „weltweiten Schadensersatz“ einzutreiben (vgl. LG Berlin II, Urteil vom 28.08.2024, Az. 15 O 260/22).
Der Sachverhalt
Zwei Gesellschaften des Musikverlags gingen gegen eine Schweizer Kantonalbank vor. Die beklagte Bank hat jedoch in Deutschland keine Niederlassung, keine örtliche Repräsentanz, keine Banklizenz und auch keinen nennenswerten deutschen Kundenstamm.
Die beklagte Bank ließ im Jahr 2014 einen Imagefilm produzieren. Der Imagefilm war zwischen 2014 und 2020 auf verschiedenen Websites der Beklagten bzw. deren französischer Tochtergesellschaft sowie auf dem YouTube-Kanal der Beklagten zugänglich und auch in Deutschland abrufbar. Die Websites sind in französischer, englischer und deutscher Sprache gehalten und enthalten Kontaktdaten (Adressen und Telefonnummern) für Frankreich und die Schweiz und verlinken auf Schweizer Top-Level-Domains.
Bestandteil des Imagefilms war ein Musikwerk, für das der Komponist das Filmherstellungs- und Werbenutzungsrecht an den Musikverlag übertragen und den Musikverlag zur Geltendmachung der urheberpersönlichkeitsrechtlichen Rechte ermächtigt hatte. Das Musikwerk war für den Imagefilm nicht lizenziert worden.
Die geltend gemachten Ansprüche des Musikverlags weisen zwei Besonderheiten auf:
1. Der Musikverlag macht nur die urheberpersönlichkeitsrechtlichen Ansprüche des Komponisten geltend.
2. Der Musikverlag begehrt (unter anderem) einen weltweiten bezifferten Schadensersatz, konkret in Höhe von 740.000 Euro.
Die Entscheidung
Der Musikverlag hatte mit seiner Klage keinen Erfolg.
Das Landgericht Berlin II entschied, dass es nach Art. 5 Nr. 3 des Luganer Übereinkommens für Urheberrechtsverletzungen außerhalb Deutschlands nicht zuständig ist und nur für die Entscheidung über diejenigen Schäden zuständig ist, die in Deutschland verursacht worden sind. Daran ändere nichts, dass vorliegend „urheberpersönlichkeitsrechtliche Ansprüche“ geltend gemacht werden. Eine Entscheidung des EuGH, wonach bei der Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch Inhalte, die auf einer Website veröffentlicht worden sind, eine Haftungsklage auf Ersatz des gesamten entstandenen Schadens am Erfolgsort erhoben werden könne (vgl. EuGH, Urteil vom 25.10.2011, C-509/09 und C-161/10 – eDate Advertising), sei im Urheberrecht nicht anwendbar.
Zudem stellte das Gericht fest, dass – insoweit das Gericht überhaupt zuständig sei – es vorliegend an einer Verletzung des Rechts der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a UrhG) fehle. Denn weder habe der Upload in Deutschland stattgefunden noch sei Deutschland der Ort, an dem der Imagefilm bzw. die Komposition der Öffentlichkeit bestimmungsgemäß zugänglich gemacht wurde. Die streitgegenständliche Werbung weise keinen besonderen Inlandsbezug auf, da unter anderem
- die Top Level Domains auf den französischen und schweizerischen Markt ausgerichtet seien,
- die Aufmachung der Websites mit Kontaktdaten für Frankreich und die Schweiz nicht auf Bundesrepublik Deutschland als Ziel hindeute, und
- die beklagte Bank mangels Niederlassung, örtlicher Repräsentanz, Banklizenz und nennenswerten deutschen Kundenstamm nicht auf Deutschland ausgerichtet sei.
Auch eine Verletzung des Urheberpersönlichkeitsrechts zur Werbenutzung (§§ 14, 23 UrhG) komme nicht in Betracht. Dieses Recht knüpfe akzessorisch an die Nutzung des urheberrechtlich geschützten Werkes im Inland an. Die Verletzung setze ebenfalls einen hinreichenden Inlandsbezug der Verletzungshandlung voraus, woran es vorliegend fehle.
Hinweise für die Praxis
Die Entscheidung des Landgericht Berlin II ist nicht rechtskräftig, der unterlegene Musikverlag ist in Berufung gegangen. Die Bedeutung der Entscheidung der Berufung ist insbesondere für Musikverlage erheblich: Sollte das Kammergericht zugunsten des Musikverlags entscheiden, könnte in vielen Fällen in Deutschland ein weltweiter Schadensersatz für eine weltweite, unlizenzierte Nutzung von Musikwerken in Videos eingeklagt werden. Die Auswirkung auf die Geltendmachung von sog. „Synch-Rechten“ wäre enorm.