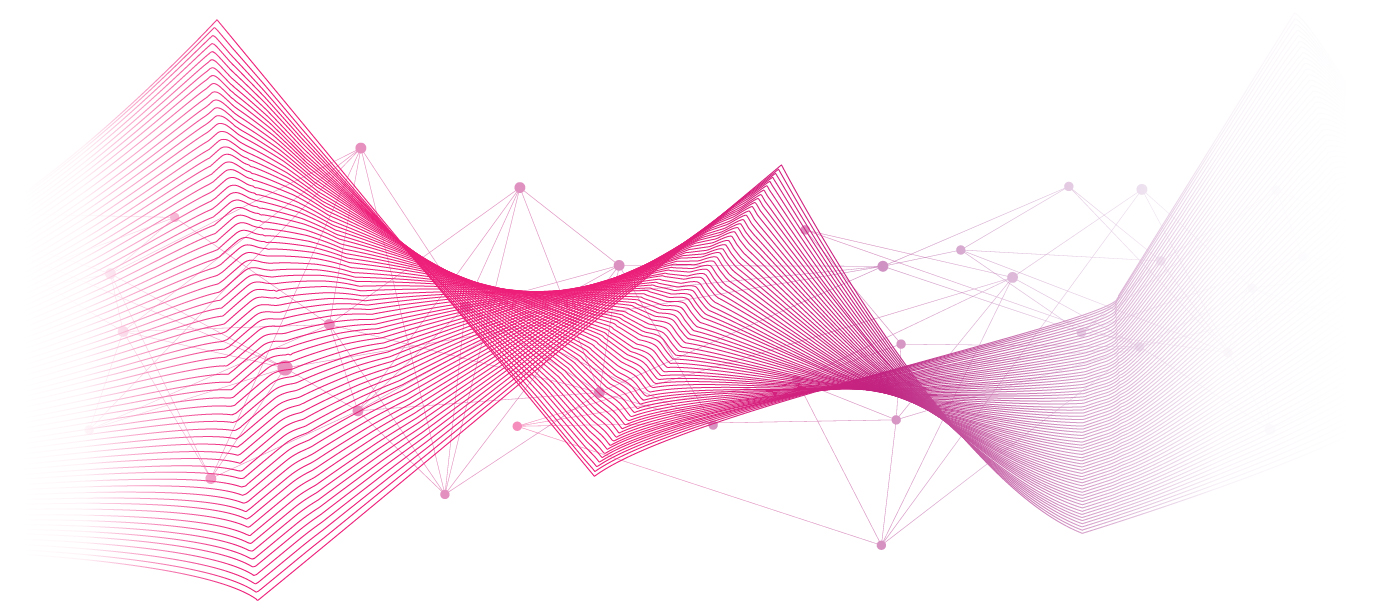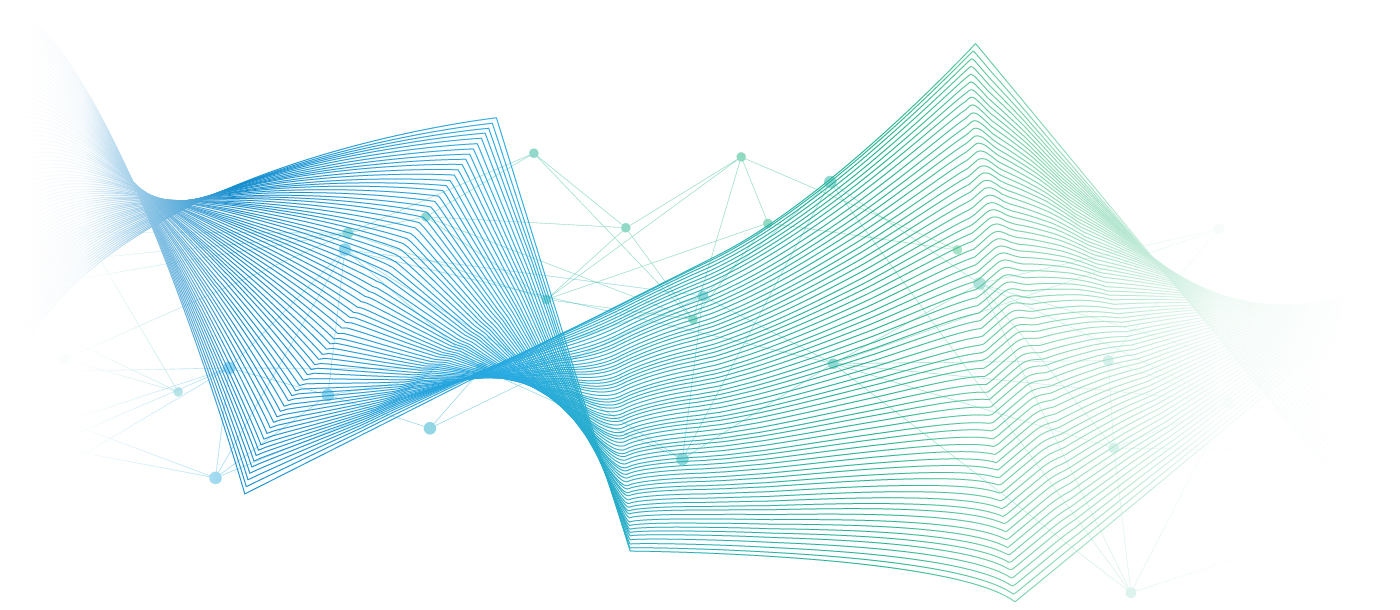Design eines Sattels: Sichtbarkeit von Bauelementen komplexer Erzeugnisse

Ein Bauelement eines komplexen Erzeugnisses muss während der „bestimmungsgemäßen Verwendung“ dieses komplexen Erzeugnisses sichtbar bleiben, um rechtlichen Musterschutz zu genießen. Der EuGH stellt jetzt klar, dass der Begriff „bestimmungsgemäße Verwendung“ weit auszulegen und die Sichtbarkeit bei „normaler“ Verwendung zu prüfen ist. Umfasst sind damit neben der hauptsächlichen Verwendung auch Handlungen, die Endbenutzer im Rahmen einer solchen Verwendung üblicherweise vornehmen, wie Aufbewahrung oder Transport.
Sachverhalt
Der EuGH befasst sich im Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens, das die Auslegung von Art. 3 Abs. 3 und 4 der Richtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen zum Gegenstand hat, mit dem Verständnis der „bestimmungsgemäßen Verwendung“ komplexer Erzeugnisse.
Startpunkt des Ausgangsrechtsstreits war ein Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit eines deutschen Designs für die Unterseite eines Sattels. Der Nichtigkeitsantrag wurde insbesondere damit begründet, dass das Design, das bei einem Sattel – und damit einem Bauelement eines komplexen Erzeugnisses wie eines Fahrrads – benutzt werde, bei bestimmungsgemäßer Verwendung dieses Erzeugnisses nicht sichtbar sei.
Das DPMA wies den Nichtigkeitsantrag zurück und führte aus, dass auch ein nicht der Instandhaltung, Wartung oder Reparatur dienendes Ab- und Aufmontieren des Sattels eine „bestimmungsgemäße Verwendung“ darstelle. Auf die gegen diese Entscheidung gerichtete Beschwerde hin erklärte das Bundespatentgericht das Design für nichtig. Zur Begründung führte es unter anderem aus, dass nur das Fahren sowie das Auf- und Absteigen als „bestimmungsgemäße Verwendung“ anzusehen seien. Dabei sei die Sattelunterseite weder für den Endbenutzer noch für einen Dritten sichtbar.
Gegen diese Entscheidung legte die Inhaberin des Designs Rechtsbeschwerde beim BGH ein. Der BGH legte dem EuGH die folgenden Fragen zur Vorabentscheidung vor:
1) Ist ein Bauelement, das ein Muster verkörpert, bereits dann „sichtbar“ im Sinne von Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 98/71, wenn es objektiv möglich ist, das Design in eingebautem Zustand des Bauelements erkennen zu können, oder kommt es auf die Sichtbarkeit unter bestimmten Nutzungsbedingungen oder aus einer bestimmten Betrachterperspektive an?
2) Wenn Frage 1 dahin zu beantworten ist, dass die Sichtbarkeit unter bestimmten Nutzungsbedingungen oder aus einer bestimmten Betrachterperspektive maßgeblich ist:
a) Kommt es für die Beurteilung der „bestimmungsgemäßen Verwendung“ eines komplexen Erzeugnisses durch den Endbenutzer im Sinne von Art. 3 Abs. 3 und 4 der Richtlinie 98/71 auf den vom Hersteller des Bauelements oder des komplexen Erzeugnisses intendierten Verwendungszweck oder die übliche Verwendung des komplexen Erzeugnisses durch den Endbenutzer an?
b) Nach welchen Kriterien ist zu beurteilen, ob die Verwendung eines komplexen Erzeugnisses durch den Endbenutzer „bestimmungsgemäß“ im Sinne von Art. 3 Abs. 3 und 4 der Richtlinie 98/71 ist?
Entscheidung
Der EuGH stellt zunächst klar, dass eine abstrakte Beurteilung der Sichtbarkeit ohne Bezug zu jedweder konkreten Situation der Verwendung eines Erzeugnisses nicht genüge. Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 98/71 verlange jedoch auch nicht, dass ein in ein komplexes Erzeugnis eingefügtes Bauelement zu jedem Zeitpunkt der Verwendung des komplexen Erzeugnisses vollständig sichtbar bleibe.
Weiter stellt der EuGH klar, dass es bei der Sichtbarkeit bei bestimmungsgemäßer Verwendung auf die Sichtbarkeit für den Nutzer selbst, aber auch die Sichtbarkeit für außenstehenden Beobachter ankomme. Der Begriff der „bestimmungsgemäßen Verwendung“ sei ferner weit – als „normale“ Verwendung – auszulegen. Der EuGH weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass in anderen Sprachfassungen die Begriffe „normale“ oder „übliche“ Verwendung genutzt werden. Es könne daher nicht allein auf die Absicht des Herstellers eines Bauelements oder eines komplexen Erzeugnisses abgestellt werden.
Vielmehr müsse der Begriff „bestimmungsgemäße Verwendung“ auch Handlungen, die mit der üblichen Verwendung zusammenhängen, sowie weitere Handlungen, die anlässlich einer solchen Verwendung vernünftigerweise vorgenommen werden können und aus Sicht des Endbenutzers üblich sind, umfassen. Eingeschlossen seien Handlungen, die vorgenommen werden, bevor oder nachdem das Erzeugnis seine Hauptfunktion erfüllt habe. Dies seien beispielsweise die Aufbewahrung oder der Transport.
Der EuGH antwortet daher auf die Vorlagefragen, dass Art. 3 Abs. 3 und 4 der Richtlinie 98/71 dahin auszulegen seien, dass das Erfordernis der „Sichtbarkeit“ im Hinblick auf eine Situation der normalen Verwendung eines komplexen Erzeugnisses zu prüfen sei, wobei es darauf ankomme, dass das betreffende Bauelement nach seiner Einfügung in dieses Erzeugnis bei einer solchen Verwendung sichtbar bleibe. Zu diesem Zweck sei die Sichtbarkeit eines Bauelements eines komplexen Erzeugnisses bei seiner „bestimmungsgemäßen Verwendung“ durch den Endbenutzer aus der Sicht dieses Benutzers sowie der Sicht eines außenstehenden Beobachters zu beurteilen, wobei diese bestimmungsgemäße Verwendung Handlungen, die bei der hauptsächlichen Verwendung eines komplexen Erzeugnisses vorgenommen werden, sowie Handlungen, die der Endbenutzer im Rahmen einer solchen Verwendung üblicherweise vorzunehmen hat, umfassen müsse. Ausgenommen Instandhaltung, Wartung und Reparatur.
Praxishinweis
Mit seiner Entscheidung ermöglicht der EuGH eine weite Berücksichtigung von Verwendungen komplexer Erzeugnisse. Neben der hauptsächlichen Verwendung können auch übliche und normale Verwendungen berücksichtigt werden.
Bei dieser Auslegung führt das Kriterium der „bestimmungsgemäßen Verwendung“ nicht zu einer zu starken Einschränkung des Designschutzes für Bauteile komplexer Erzeugnisse, was zu begrüßen ist. Im Rechtsstreit ist es als Inhaber von Designs dann besonders wichtig, übliche Verwendungsweisen darzulegen.