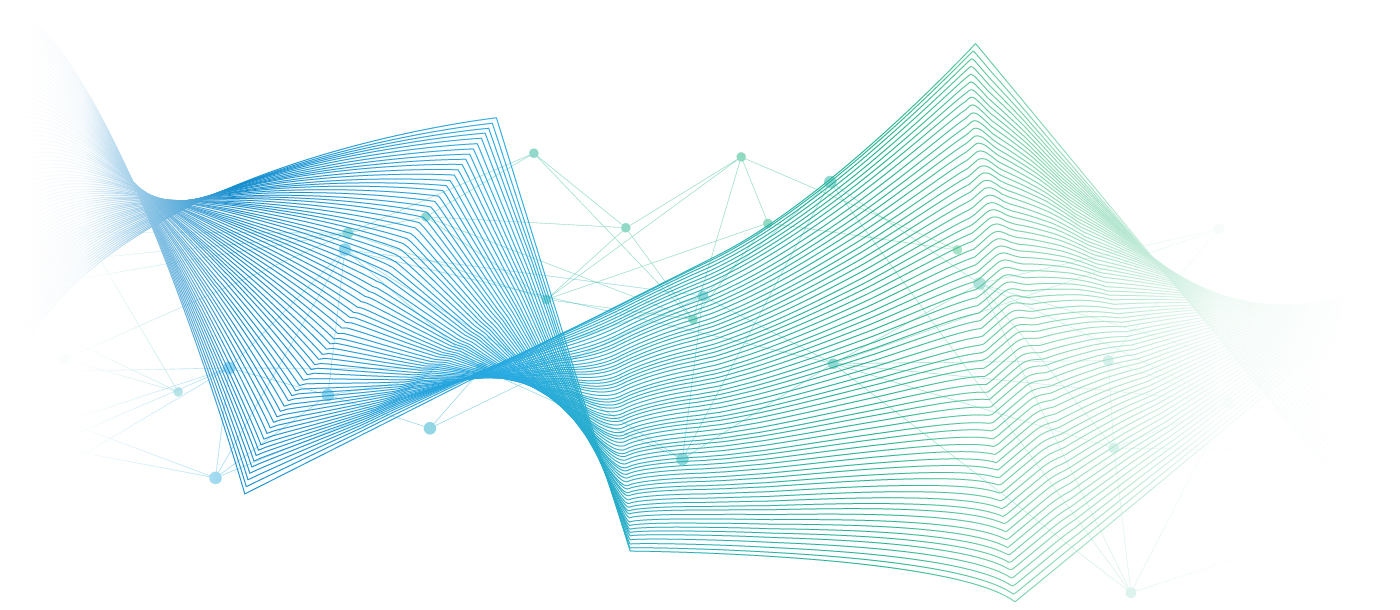Ist DAS das Ende der deutschen Medienregulierung von Plattformen?

Eher unscheinbar kam kurz vor Weihnachten ein Beschluss des VG Berlin heraus (vgl. Beschluss vom 17.12.2024, Az. 32 L 221/24): Spotify müsse einstweilen nicht die Transparenzvorgaben nach § 93 des Medienstaatsvertrags (MStV) umsetzen. So weit so unspektakulär, mag man denken, wenn man nicht gerade Spotify oder die Medienanstalt Berlin-Brandenburg ist. Tatsächlich enthält der Beschluss des VG Berlin aber richtig Sprengkraft – und zwar Sprengkraft für den Fortbestand der deutschen Medienregulierung von Plattformen!
Worum geht es in dem Verfahren vor dem VG Berlin?
Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg hatte im Sommer 2024 gegenüber Spotify einen Bescheid erlassen, indem diese
- beanstandete, dass die Transparenzangaben von Spotify nicht den Anforderungen des § 93 MStV entsprechen, und
- Spotify aufgab, die Transparenzanforderungen des § 93 MStV umzusetzen.
Spotify klagte gegen diesen Bescheid und stellte zudem einen Antrag im einstweiligen Rechtsschutz. Über den Antrag im einstweiligen Rechtsschutz entschied nun das VG Berlin.
Was hat das VG Berlin entschieden?
Das VG Berlin hat entschieden, dass Spotify einstweilen nicht die Transparenzvorgaben des § 93 MStV umsetzen müsse. In der Begründung führt das VG Berlin aus, dass es die Anwendung der Transparenzvorgaben des § 93 MStV auf Spotify für unionsrechtswidrig und damit für unanwendbar halte. Die Frage der Unionsrechtswidrigkeit werde das VG Berlin dem EuGH zur Entscheidung vorlegen.
Warum ist diese Entscheidung so spektakulär?
Um die Tragweite der Entscheidung des VG Berlin einzuordnen, muss man sich vor Augen halten, dass zentrale Regelungen des MStV nicht nur auf Plattformen mit Sitz in Deutschland anwendbar sind. Vielmehr sind auf alle sog. Medienintermediäre, Medienplattformen und Benutzeroberflächen die für sie jeweils relevanten Regelungen des MStV anwendbar, soweit der Medienintermediär, die Medienplattform oder die Benutzeroberfläche zur Nutzung in Deutschland bestimmt ist (vgl. § 1 Abs. 8 Satz 1 MStV).
Die Regelung des § 1 Abs. 8 Satz 1 MStV führt dazu, dass auch eine Plattform mit Sitz im EU-Ausland wie Schweden oder Irland zentrale Regelungen des MStV einhalten muss. Der Sitz im EU-Ausland „schützt“ also insoweit nicht vor der Anwendbarkeit des deutschen Medienrechts. Faktisch werden mit der Regelung des § 1 Abs. 8 Satz 1 MStV die Vorgaben des MStV auf alle Medienintermediäre, Medienplattformen und Benutzeroberflächen erstreckt, die in Deutschland aktiv bzw. nutzbar sind.
Genau DAS könnte sich jetzt aber ändern!
Denn das VG Berlin geht davon aus, dass die Erstreckung der Transparenzpflichten des § 93 MStV über § 1 Abs. 8 MStV auf Plattformanbieter mit Sitz im EU-Ausland gegen das in der E-Commerce-Richtlinie verankerte Herkunftslandprinzip verstößt und damit unanwendbar sei. Schließt sich der EuGH der Meinung des VG Berlin an, kann dies in der Folge bedeuten, dass sämtliche Regelungen des deutschen Medienrechts auf Medienintermediäre, Medienplattformen und Anbieter von Benutzeroberflächen mit Sitz im EU-Ausland nicht anwendbar sind! Faktisch kann dies dann dazu führen, dass weite Teile des deutschen Medienrechts schlicht leerlaufen würden, da eine Vielzahl an Plattformen ihren Sitz eben nicht in Deutschland hat, sondern im EU-Ausland.
Wie wird der EuGH entscheiden?
Ausgehend von der jüngsten Rechtsprechung des EuGH ist es gut möglich, dass der EuGH sich der Meinung des VG Berlin anschließen und die Erstreckung der Transparenzpflichten des § 93 MStV auf Plattformen mit Sitz im EU-Ausland für unionsrechtswidrig halten wird.
Der EuGH hat bereits eine nationale Regelung unter Verweis auf das „Herkunftslandprinzip“ der E-Commerce-Richtlinie für unionsrechtswidrig erklärt (vgl. EuGH (2. Kammer) Urteil vom 9.11.2023, Az. C-376/22 (Google Ireland Limited ua/Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria)). In der damaligen EuGH-Entscheidung ging es um das österreichische Kommunikationsplattformen-Gesetz, das Plattformen wie Meta, Google oder TikTok unter anderem dazu verpflichten sollte, ein Melde- und Überprüfungsverfahren für behauptete rechtswidrige Inhalte einzurichten. Der EuGH entschied damals, dass jede Plattform grundsätzlich der Aufsicht im „Herkunftsmitgliedsstaat“ unterliege und sich hieraus zwei Grundsätze ergeben:
1. Es obliegt (nur) dem „Herkunftsmitgliedsstaat“ (also dem Mitgliedsstaat, in dem die Plattform ihren Sitz hat), die Plattform zu regulieren (vgl. Rn. 43), und
2. Jeder „Bestimmungsmitgliedstaat“ (also der Mitgliedsstaat, in dem die Plattform genutzt wird) den freien Verkehr von Plattformen nicht dadurch einzuschränken hat, dass er die Einhaltung zusätzlicher Verpflichtungen vorschreibt (mit Ausnahme der von der E-Commerce-Richtlinie gestatteten Ausnahmen) (vgl. Rn. 44).
Diese beiden Grundsätze hat der EuGH in einer weiteren Entscheidung im Zusammenhang mit Maßnahmen der italienischen Behörde AGCOM gegen Google bestätigt (vgl. EuGH (2. Kammer) Urteil vom 30.5.2024, Az. C-664/22, C-666/22 (Google Ireland Ltd/AGCOM), Rn. 58-61).
Was bedeutet das jetzt alles?
Für Medienanstalten wie für ausländische Medienintermediäre, Medienplattformen und Anbieter von Benutzeroberflächen stellt sich nach der Entscheidung des VG Berlin die ganz grundsätzliche Frage, ob und inwieweit Regelungen der deutschen Medienregulierung auf diese Plattformen überhaupt anwendbar sind. Ganz konkret stellen sich damit zwei Fragen zu sehr kontroversen Bereichen der deutschen Medienregulierung, nämlich:
1. Müssen die Vorgaben zu „Transparenzangaben“ – vor allem zu Transparenz über die Funktionsweise von Algorithmen – umgesetzt werden?
2. Müssen die Vorgaben zu „Public Value“ – vor allem die Sortierung von Sendern nach den „Public Value“-Vorgaben – umgesetzt werden?
Jedenfalls mit Blick auf Medienintermediäre, Medienplattformen und Anbieter von Benutzeroberflächen mit Sitz im EU-Ausland könnte der EuGH schon bald mehr Klarheit schaffen. Bis dahin gibt es jetzt einen „Schwebezustand“.